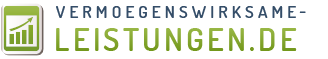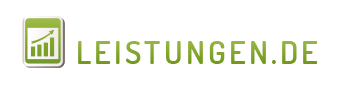Das 5. Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) ist kompliziert, unübersichtlich, und besteht aus 18 Paragraphen. Wir haben die wichtigsten Punkte der Verordnung analysiert, neu gegliedert und für Laien kurz und verständlich zusammengefasst.
- Das 5. Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) regelt die genauen Bedingungen für vermögenswirksame Leistungen.
- Darin enthalten sind z.B. Anspruch, Anlagemöglichkeiten, staatliche Förderung sowie Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
- Sinn und Zweck der Verordnung ist, Personen mit niedrigeren Einkommen dabei zu helfen, langfristig Vermögen aufzubauen.
Was ist das 5. Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG)?
Wie viele Dinge in Deutschland sind auch vermögenswirksame Leistungen über ein Gesetz geregelt. Alles, was man zum Thema VL wissen muss, findet man im sogenannten 5. Vermögensbildungsgesetz (kurz: 5. VermBG). Die ausführliche Definition lautet: „Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer“. Darin steht z.B., wer alles vermögenswirksame Leistungen bekommt, wie man das Geld anlegen kann, und unter welchen Voraussetzungen sich der Staat mit einer Förderung beteiligt. Ziel der Verordnung ist, Beschäftigte mit geringerem Einkommen beim Vermögensaufbau zu unterstützen, wie z.B. Rücklagen zu bilden, Kapital für eine eigene Immobilie anzusparen, oder sich ein weiteres Standbein für die Altersvorsorge aufzubauen.
Was sind vermögenswirksame Leistungen?
(§ 2): Vermögenswirksame Leistungen (VL) sind Geldleistungen, die ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zusätzlich zum monatlichen Gehalt gewährt. Das Geld wird jedoch nicht mit dem Lohn ausgezahlt, sondern in einen Sparvertrag anlegt.
- Die Leistung ist üblicherweise Sache des Arbeitgebers. Alternativ kann der Arbeitnehmer auch Teile seines Nettolohns umwandeln und als VL anlegen.
- Der Betrieb überweist das Geld direkt an das Anlageinstitut, also die gewählte Bank, Fondsgesellschaft, Versicherung oder Bausparkasse.
- VwL sind als Bestandteil des Lohns steuer- und sozialabgabenpflichtig.
- Sie sind nicht übertragbar, und damit auch nicht pfändbar.
Wer hat laut 5. VermBG Anspruch auf VL?
(§ 1, § 3): Nicht jeder bekommt vermögenswirksame Leistungen. Das 5. Vermögensbildungsgesetz legt fest, wer Anspruch auf VL hat. Begünstigt sind demnach Personen, die in ihrem Unternehmen oder einer Behörde fest angestellt sind.
- Dazu gehören in erster Linie Arbeitnehmer (Angestellte, Arbeiter, Azubis) – auch in Teilzeit.
- Ebenso berechtigt sind Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit und Berufssoldaten.
- VL können auch für nahe Angehörige, wie Ehe-/ Lebenspartner, Kinder oder Eltern des anspruchsberechtigten Arbeitnehmers angelegt werden.
- Keinen Anspruch haben Selbständige, Freiberufler, Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer einer GmbH, ehrenamtliche Richter sowie Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen.
Welche Anlageformen sind erlaubt?
(§ 2, § 4 bis § 9): Vermögenswirksame Leistungen dürfen gemäß 5. VermBG nur in bestimmte Sparformen angelegt werden. Diese müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, wie z.B. eine Mindestlaufzeit (sog. Sperrfrist) von 7 Jahren gewährleisten. Zu den erlaubten Anlageformen gehören:
- Fonds / ETFs, Aktien und Beteiligungen (z. B. Genossenschaftsanteile, GmbH-Anteile, Genussrechte)
- Bausparverträge (VL-Bausparvertrag) oder Tilgung von bestehenden Baukrediten.
- Kapitallebensversicherungen mit einer Mindestlaufzeit von 12 Jahren
- Betriebliche Altersvorsorge: entweder klassisch arbeitgeberfinanziert oder als Entgeltumwandlung.
- Sparverträge bei Banken (VL-Banksparplan)
Freie Wahl und Vertragsgestaltung
(§ 10, § 11, § 12): Arbeitnehmer können selbst bestimmen, wie und wo sie ihre vermögenswirksamen Leistungen anlegen. Gleichzeitig regeln die §§ 10 bis 12 des 5. Vermögensbildungsgesetzes, unter welchen Bedingungen VL vereinbart und aus dem Lohn abgeführt werden können.
- Die Zahlung von vermögenswirksamen Leistungen ist für Arbeitgeber grundsätzlich freiwillig. Ein Anspruch für den Arbeitnehmer kann jedoch über den Tarifvertrag, Arbeitsvertrag oder eine Betriebsvereinbarung verbindlich geregelt werden.
- Die staatliche Förderung wird nur gewährt, wenn der Vertragsinhaber die Anlageform und das Institut selbst wählen darf.
- Eine Beteiligung am eigenen Arbeitgeber (z.B. über Aktien, Genossenschafts- oder GmbH-Anteile), ist nur mit dessen Zustimmung erlaubt.
- Beschäftigte dürfen verlangen, dass Teile ihres Nettolohns vermögenswirksam angelegt werden.
- Ein bestehender VwL-Vertrag kann vom Arbeitnehmer einmal pro Jahr geändert oder gekündigt werden. Für neue Verträge nach einer Kündigung im selben Jahr besteht kein Anspruch.
Staatliche Förderung
(§ 13, § 14): Wer vermögenswirksame Leistungen anlegt, hat unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine staatliche Förderung, die sogenannte Arbeitnehmersparzulage.
- Je nach gewählter Sparform fällt die Förderung unterschiedlich hoch aus:
- 20 % auf maximal 400 € jährliche Sparleistung bei der Anlage in VL-Fondssparen, Aktien oder Beteiligungen
- 9 % auf maximal 470 € jährliche Sparleistung bei Einzahlung in einen Bausparvertrag oder Tilgung eines Baukredits
- Der Arbeitnehmer beantragt die Zulage einmal pro Jahr beim Finanzamt. Das Finanzamt überweist diese jedoch erst zum Ende der Laufzeit auf das Anlagekonto.
- Wichtige Voraussetzung ist die Einhaltung der Sperrfrist. Hierbei handelt es sich um die bei VL übliche siebenjährige Laufzeit. Diese setzt sich aus einer sechsjährigen Einzahlungsphase sowie einem Ruhejahr zusammen (sogenannte 6 + 1 Regel).
- Wird die Sperrfrist nicht eingehalten, verfällt der Anspruch (Ausnahmen bei Tod, Erwerbsunfähigkeit etc.).
- Für den Bezug gelten zudem bestimmte jährliche Einkommensgrenzen.
Meldung, Nachweise und elektronische Datenübermittlung
(§ 15): Damit die Zulage korrekt beantragt und gezahlt werden kann, verpflichtet das 5. VermBG Arbeitgeber und Anlageinstitute zu bestimmten Meldungen und Nachweisen.
- Arbeitgeber und Anlageinstitut müssen die Anlage als vermögenswirksame Leistung kennzeichnen.
- Die Sparzulage wird vom Arbeitnehmer im Rahmen seiner Steuererklärung formlos durch Ankreuzen beantragt. Die benötigten Daten erhält das Finanzamt vom Anbieter über die sogenannte elektronische Vermögensbildungsbescheinigung.
- Arbeitnehmer müssen der Datenübermittlung zustimmen.
- Das Finanzamt kann die Anlageinstitute jederzeit auf korrekte Umsetzung prüfen.
Sonderfälle, alte Verträge und Übergangsregeln
(§ 17, § 18): Für Altverträge, die vor dem 1. Januar 1994 abgeschlossen wurden, gelten zum Teil andere Vorschriften. Das 5. Vermögensbildungsgesetz berücksichtigt diese mit Übergangsregelungen.
- Für vor 1994 abgeschlossene Verträge gibt es Sonderkündigungsrechte und Altregelungen.
- In diesen Fällen können andere Fristen und Bedingungen gelten.
- 1. Im Betrieb nach VL erkundigen
- 2. Anlageprodukt auswählen
- 3. Vertrag online abschließen.
- 4. Arbeitgeber VL-Bescheinigung übergeben.